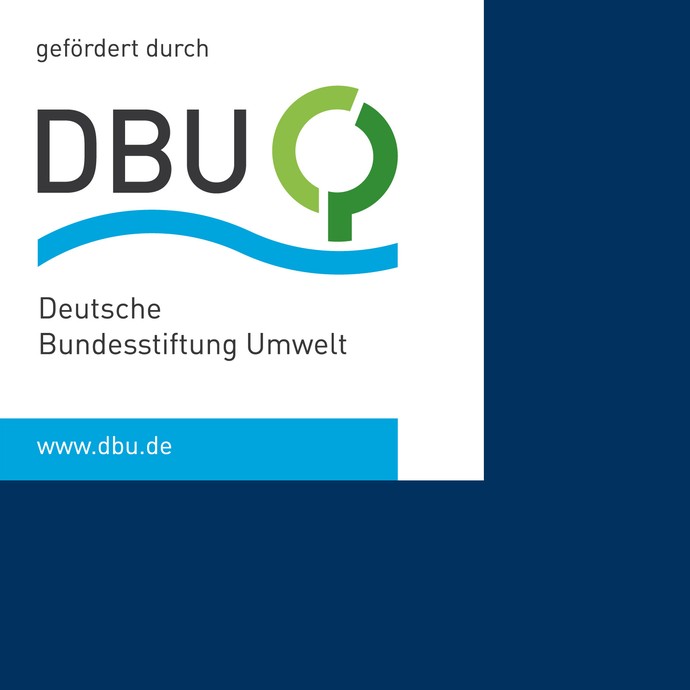Wichtige Erkenntnisse
Über den Praxisleitfaden hinaus hat das Forschungsprojekt die bestehenden Erkenntnisse zu Objekten aus Baumberger Kalksandstein, die durch Althydrophobierung vorgeschädigt sind, ergänzt und aktualisiert:
- Baumberger Kalksandstein lässt sich nicht gleichmäßig hydrophobieren.
- Eine Hydrophobierung verstärkt die Schadensprozesse.
- Der Verfall von Denkmälern aus Baumberger Kalksandstein ist langsamer als früher vermutet. Der Erhalt originaler, historischer Substanz ist deshalb noch in weiten Teilen möglich.
- Der langfristige Erhalt gelingt durch objektspezifische Strategien.
- Schutz- und Verschleißschichten haben sich in der Praxis vielfach bewährt. Diese verwittern statt des originalen Gesteins.
- Schadensvorsorge durch Monitoring und Wartung ist hocheffizient und kostengünstig.
- Schutzeinhausungen schützen die Denkmäler effektiv im Winter.
- Der Klimawandel bedroht Denkmäler aus Baumberger Kalksandstein stärker.
Althydrophobierung
Eine gleichmäßige Hydrophobierung ist nicht möglich
Eine Hydrophobierung, auch als hydrophobierende Imprägnierung bezeichnet, ist ein nicht filmbildender Oberflächenschutz für mineralische Baustoffe mit wasserabweisender Wirkung. Sie kann auf verschiedenen Baumaterialien wie Beton, Mörtel und Naturstein angewendet werden. Bei früheren Maßnahmen kamen mitunter auch bei Festigungen hydrophobierende Mittel zum Einsatz.
Bei Objekten aus Baumberger Kalksandstein, deren Oberflächen mit hydrophobierenden Mitteln wasserabweisend behandelt wurden, zeigt sich, dass frühere Hydrophobierungen heute meist sehr ungleichmäßig auftreten. Die Untersuchung solcher Objekte offenbart häufig eine heterogene Verteilung von hydrophoben und hydrophilen Eigenschaften, sowohl an der Oberfläche als auch im Tiefenprofil des Steins.
Dies führt zu vier wichtigen Beobachtungen:
- Die Eindringtiefe der Hydrophobierungsmittel ist oft begrenzt. Typischerweise findet man eine dünne hydrophile Oberflächenschicht (1-2 mm), gefolgt von einer hydrophoben Schicht von einigen Millimetern Dicke, darunter liegt dann wieder unbehandeltes Steinmaterial.
- Im Tiefenprofil können sich abwechselnde Schichten mit unterschiedlichen Wassertransporteigenschaften bilden, was die Schalenbildung und damit den Verfall des Steins beschleunigen kann.
- Wie aktuelle Laboruntersuchungen gezeigt haben, haben diese wechselnden Bereiche von hydrophoben und hydrophilen Eigenschaften im Stein unterschiedliche petrophysikalische Eigenschaften, was in der Konsequenz eine Zunahme von Scherkräften bedeutet, die eine Schichtentrennung bzw. Ablösung der Schichten voneinander bewirken kann.
- Die ungleichmäßige Verteilung von hydrophoben und hydrophilen Bereichen erschwert die Anwendung von Konservierungsmitteln. Diese müssen sowohl auf wasserabweisenden als auch auf wasserdurchlässigen Flächen haften können.
Aktuelle Laborversuche zeigen, dass selbst moderne Hydrophobierungsmittel unter optimalen Bedingungen – z.B. unter Vakuum – nur 1-2 mm tief eindringen. Diese begrenzten Tränkungstiefen legen nahe, von einer erneuten Hydrophobierung als abschließendem Schritt bei aktuellen Konservierungsmaßnahmen abzusehen.
Verwitterungsprozesse
Althydrophobierungen verstärken die Schäden
Abschuppen, Schalenbildung, Mürbzonen und Risse sind typische Verwitterungsphänomene in Baumberger Kalksandstein.
Diese können u.a. im Zusammenhang mit Salzbelastungen im Stein gesehen werden, die sich aufgrund anthropogen bedingter Umwelteinflüsse – wie z.B. Schwefeloxidbelastungen – gebildet haben. Die Horizonte der Salzbelastung im Steingefüge reichen aufgrund kapillaren Transports einige Millimeter in die Tiefe des Steinmaterials, wo die zuvor im Transportwasser gelösten Salze kristallisieren und sich anreichern – akkumulieren. Diese Prozesse gehen mit einer Volumenvergrößerung einher, was zur Zerrüttung und zum Abschuppen des Steinmaterials führen kann.
Auch kann die Gefüge-Zerrüttung mit den in der stützenden Matrix des Gesteins fein verteilten Tonmineralen verbunden werden. Die Volumenzunahme quellfähiger Tonminerale bei Wasseraufnahme und ihr nachfolgendes Schrumpfen bei Trocknungsprozessen kann langfristig zu einer fortschreitenden Entfestigung des Steingefüges führen und dieses zermürben.
Neben bauschädlichen Salzen und quellfähigen Tonmineralen kann auch gefrierendes Wasser in den oberflächennahen Poren des Gesteins einen gravierenden Einfluss auf die Schädigung des Materials haben. Baumberger Kalksandstein hat einen sehr hohen Wassersättigungswert und trocknet langsam, was dazu führen kann, dass bei Frosteintrag das im Stein befindliche Wasser gefriert. Auch diese Eiskristallisation geht mit einer Volumenvergrößerung einher, was zur Zerrüttung des Steinmaterials führt.
Diese Schadensprozesse sind an unbehandeltem Baumberger Kalksandstein zu beobachten. Darüber hinaus haben Laboruntersuchungen gezeigt, dass mit hydrophobierenden Mitteln behandelter Baumberger Kalksandstein ein verändertes Dehnungsverhalten bei Temperatur- und Feuchte-Einfluss hat. Außerdem werden die Festigkeiten erhöht und die Elastizität gleichzeitig verringert.
Das bedeutet, dass Bereiche im Gestein, die mit hydrophobierenden Mitteln behandelt wurden, ein anderes Materialverhalten als unbehandelte Steinbereiche aufweisen.
Bei Einfluss durch Temperatur, Wasser oder mechanische Kräfte, wie die oben beschriebenen Kristallisationsprozesse, führt das unterschiedliche Materialverhalten zu stärkeren Spannungen und Scherkräften, die das Steingefüge zusätzlich schädigen.
Das beobachtete unterschiedliche Materialverhalten macht sich insbesondere an den Grenzflächen (hydrophob/hydrophil) intensiv bemerkbar. von Proben, die mit Hydrophobierungsmittel behandelt wurden im Vergleich zu unbehandelten Proben, kann die Scherkräfte insbesondere an den Grenzflächen intensivieren. Selbst unter Laborbedingungen lassen sich Proben aus Baumberger Kalksandstein nicht vollständig oder mit einem homogenen Verlauf durchtränken. Das heißt, mit Hydrophobierungsmittel behandelter Baumberger Kalksandstein zeigt ein stark inhomogenes Erscheinungsbild mit manigfachen hydrophob/hydrophilen Grenzflächen. Insofern ist davon auszugehen, dass Hydrophobierungen und die daraus resultierenden hydrophob/hydrophilen Objektzustände die Schädigungsprozesse in Baumberger Kalksandstein negativ verstärken.
Schadensprognose und -verlauf
Baumberger Kalksandstein verwittert langsamer als gedacht
Der Schadensverlauf am Baumberger Kalksandstein des Schlosses Münster als eines der prominentesten Denkmäler aus Baumberger Kalksandstein zeigt sich weniger dramatisch als zunächst befürchtet. Obwohl das Schloss seit Jahren im Fokus von Untersuchungen und Maßnahmenkonzeptionen steht, hat sich die Situation nicht so stark verschlechtert wie erwartet.
Bereits 1996 wurden verhärtete Oberflächen mit darunterliegenden sandenden Zonen sowie Schalenbildung festgestellt. Ein Bericht von 2013 prognostizierte eine "deutlich exponentielle Schadensentwicklung" und wies auf ein heterogenes Saugverhalten sowie überfestigte Oberflächen mit subkrustalen Lockerzonen hin. Eine Maßnahme folgte derzeit nicht. Trotz dieser Prognose zeigte sich, dass die Oberflächen verhältnismäßig wenig Schäden aufwiesen. Eine jüngere Untersuchung aus dem Jahr 2017 identifizierte Schalenbildung als markantes Schadensphänomen, möglicherweise als Folge früherer Hydrophobierungsmaßnahmen.
Daraufhin wurden konservatorisch-restauratorische Maßnahmen an einer Musterfläche durchgeführt, darunter Reinigung, Salzminderung, Fixierung von Schalen und Sicherung der Schalenränder. Fehlstellen wurden zurückhaltend durch Vierungen geschlossen, desolate Quader in Naturstein ausgetauscht. Abschließend erfolgte ein Schlämm-Auftrag auf Kalkbasis als Schutz- und Opferschicht.
Ein Vergleich der Objektzustände von 1996, 2013, 2017 und 2020 zeigt keine gravierenden Zunahmen an Substanzverlust über einen Zeitraum von über 20 Jahren. Bereiche mit Schalenbildung blieben weitgehend unverändert, was auf eine instabile, aber beständige Schadenssituation hindeutet. Allerdings wurde zwischen 2013 und 2017 eine Zunahme der Schalenbildung in zuvor als abschuppend markierten Bereichen beobachtet, was als mögliches Indiz für eine fehlende Wartung gesehen werden kann.
Auch wenn sich die Schadenssituation nicht gravierend verändert hat, so ist trotz der relativ stabilen Situation ein restauratorisches Handeln in Sinne von Wartung und Pflege notwendig, um die fortschreitende Schädigung zu minimieren. Die aktuellen Maßnahmen umfassen Fixierung, Schalenhinterfüllung, Rissinjektion und das Aufbringen einer Schlämme als Schutz- oder Opferschicht. Von einer Hydrophobierung wird 2020 aufgrund negativer Erfahrungen abgesehen.
Insgesamt zeigt sich, dass der Schadensverlauf am Baumberger Kalksandstein des Schlosses Münster zwar fortschreitet, aber nicht so dramatisch wie befürchtet. Regelmäßige Wartung und Pflege sind entscheidend für die langfristige Erhaltung des Denkmals
Schutz- und Verschleißschichten
Für den Schutz des Originals
Wie wir im Lauf des Projekts lernen konnten, zeigen sich an Baumberger Kalksandstein vielschichtige Schäden, jedoch ist der weitere Verlauf der Schädigung nicht so gravierend, wie auf den ersten Blick zu vermuten ist. Das gibt die Chance, das Steinmaterial konservierend zu behandeln: so viel Originalsubstanz wie möglich zu erhalten und mit Schutz- und Verschleißschichten zu arbeiten. Diese Opferschichten sind als erste vom Verwitterungsangriff betroffen und schützen somit den Originalstein.
Neben substanzerhaltenden Maßnahmen wie z. B. struktureller Festigung, Injektion, Vernadelung und Hinterfüllung sind vor allem Beschichtungen, Schlämmaufträge, Anböschungen und Mörtelergänzungen als Verschleiß- und Opferschichten zu sehen.
Bei tiefgreifenden Schädigungen können Vierungen aus Naturstein den Erhalt des originalen Steins und möglicher Zeugnisse früherer Bearbeitungstechniken ermöglichen, bevor ein Steinaustausch gewählt wird, der mit dem unwiederbringlichen Verlust an Originalsubstanz einhergeht.
Zielführend ist der Erhalt von größeren intakten Steinschalen durch Fixierung und Hinterfüllung mit abschließendem Flankenverschluss durch Anböschung. Bei Schädigungen von einigen Zentimetern Tiefe haben handwerklich ausgeführte Mörtelergänzungen eine lange Standzeit bewiesen. Desolate und zermürbte Bereiche des jeweiligen Werksteins können abgearbeitet und ausgekastet werden, um nass in nass eine Mörtelergänzung von versierten Fachleuten aufzutragen. Ähnlich kann bei Vierungen gearbeitet werden, um dann eine passgenau gearbeitete Vierung aus Naturstein einzusetzen.
Insbesondere im Werksteinbereich sind handwerklich ausgeführte Mörtelergänzungen oder Vierungen gegenüber Anböschungen von Flankenkanten, die quer über die Werksteinoberfläche verlaufen, abzuwägen. Die Wasserführung an der Steinoberfläche kann so zwar reguliert werden, jedoch kann diese neue Oberflächengliederung der orientierungslos verlaufenden Anböschungen mitunter die ursprüngliche Linienführung durch Baugliederung und Fugenverlauf optisch beeinträchtigen. Durch die vielen Oberflächenversprünge vergrößert sich insgesamt die Verwitterungsfläche.
Die Vorteile dieser Maßnahme liegen auf der Hand: Mörtelergänzungen erzeugen bedeutend geringere Sanierungs-/Restaurierungs-Kosten und unterstützen den Erhalt des ursprünglichen Steins, der durch die Mörtelantragung besser geschützt ist. So greift zukünftig die Witterung zuerst die Mörtelergänzung anstelle der originalen Steinsubstanz an – die Mörtelergänzung fungiert also auch als eine robuste Verschleiß- oder Opferschicht.
Demgegenüber kann ein Steinaustausch ein Kostentreiber bei Sanierungsmaßnahmen werden. Bei Steinaustausch ist zu beachten, dass Baumberger Kalksandstein der heutzutage zugänglichen Steinbrüche eine geringere Verwitterungsresistenz im Vergleich zum historisch verbautem Steinmaterial hat. Mit anderen Natursteinarten ist der Baumberger Kalksandstein meist nicht kompatibel und „leidet“ unter dem neuen Nachbarn durch stärkeren Zerfall. Dies kann eine Ausweitung der Ultima-Ratio-Maßnahme in folgenden Sanierungen haben.
Einhausung und Winterschutz
Klimawandeladaption: Präventive Konservierung durch Wintereinhausungen
Baumberger Kalksandstein ist aufgrund seiner Wassertransporteigenschaften frostgefährdet. Die im Wechsel von Frost und Tau ablaufende Zerrüttung des Gefüges wird durch frühere irreversible Imprägnierungs- oder Hydrophobierungsmaßnahmen verstärkt. Dieser Vorschädigung durch Althydrophobierungen ist mit Maßnahmen der Präventiven Konservierung zu begegnen: Schutzdächer, Wintereinhausungen, Überdachungen u. Ä.
Meist werden Wintereinhausungen für die Zeit "von O bis O" – von Oktober bis Ostern – erstellt, was die meisten Frostereignisse von den Denkmälern fernhält. Diese Maßnahmen sind vollständig reversibel und können bei Bedarf angepasst werden, was auch in Hinblick auf den Klimawandel und immer höhere Feuchteeinträge bis hin zu Extremwettersituationen von entscheidender Bedeutung ist.
Gleichwohl sind beim Bau und Errichten der Einhausungen mehrere Aspekte zu bedenken. Vor allem müssen sie den klimatischen Anforderungen von Temperatur und Luftaustausch gerecht werden, außerdem stabil und windfest gebaut sein, praktikabel im Auf- und Abbau sowie ästhetischen Ansprüchen genügen. Die Schutzverkleidungen können aus Holz, Metall, Stoffbahnen oder Membranen etc. gebaut sein. Auf eine gewisse Luftzirkulation und Luftwechselrate muss bei allen Verkleidungen geachtet werden (z. B. Montage mit höherem Abstand zur Wand). Starke Sonneneinstrahlung sollte wegen Aufheizungseffekten vermieden werden. Klimamessungen unterstützen die Kontrolle der Wirksamkeit der Winterschutzhauben.
Nachkontrollen bestehender Wintereinhausungen zeigen, dass sie die Feuchtebelastung und den biogenen Befall eindämmen, wodurch z. B. die Reinigung der Oberflächen weniger häufig erfolgen muss. Auch zeigt die regelmäßige Wartung bei Auf- und Abbau der Einhausung, dass Konservierungsmaßnahmen nur in einem sehr geringen Umfang notwendig sind.
Digitales Monitoring
Moderne Drohnentechnologie revolutioniert das Bauwerks-Monitoring
Im Rahmen des Projektes ist das drohnengestützte SfM-Monitoring als innovative Methode entwickelt worden: ein Monitoring mittels Drohnen-Befliegung (UAV) zur Dokumentation mit Structure-from-Motion-Bildserien (SfM).
Monitoring ist für Objekte aus Baumberger Kalksandstein ein grundlegendes Instrument für den langfristigen Erhalt, denn sie sind häufig durch eine Althydrophobierung vorbelastet und der Stein hat keine sehr hohe Verwitterungsresistenz im Außenbereich. Das Monitoring beobachtet, untersucht und bewertet in nach individuell festgelegten Zeitintervallen den Zustand des Denkmals. So können bereits frühzeitig Veränderungen erkannt und behoben werden, bevor es zu Schäden kommt. Damit können umfangreiche und teure Restaurierungen oder Sanierungen vermieden werden.
Bei kleineren, meist bildhauerisch bearbeiteten Objekten – wie Bildstöcken, Kreuzwegstationen und Wegekreuzen – ist ein regelmäßiges Monitoring aufgrund der guten Zugänglichkeit mit relativ geringem Aufwand zu bewerkstelligen. Anders sieht dies bei größeren Objekten aus, vor allem, wenn Bereiche schwer oder nur mit erhöhtem Aufwand mit einer Hubarbeitsbühne oder einem Gerüst zugänglich sind, wie beispielsweise an hohen Fassadenflächen und Dachbekrönungen.
Mittels des innovativen „UAV-gestützten SfM-Monitorings“ können im Vorfeld festgelegte repräsentative Bereiche in festgelegten Zeitintervallen mit der Drohne beflogen und ihr Zustand fotografisch erfasst werden. Dabei wird mit der Structure-from-Motion-Technik ein dreidimensionales Abbild angefertigt, was mit früheren 3D-Oberflächenmodellen abgeglichen wird. So können Veränderungen bereits im mikroskopischen Bereich erkannt und notwendige Maßnahmen veranlasst werden.
Die SfM-Aufnahme erstellt ein dreidimensionales Polygonnetz der Objektoberfläche. Im rechnerischen Abgleich der Oberflächen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Monitorings durch fotografische SfM-Technik erzeugt werden, können mikrotopographische Veränderungen erkannt werden. Dies ermöglicht eine rechnergestützte Volumenermittlung der Objektveränderung, wobei eine Volumenzunahme von einer Volumenabnahme in einer skalierten Falschfarbendarstellung unterschieden wird. So können beispielsweise Dehnungsprozesse – z. B. durch Hohlraumbildung – oder ein mikroskopischer Substanzverlust frühzeitig erkannt werden, bevor es zu größerem, unwiederbringlichem Materialverlust oder gar Verkehrsgefährdung kommt.
Durch diese innovative Monitoring-Methode, den Einsatz von Drohnen und 3D-Modellierungen können schwer zugängliche Bereiche an Denkmälern ohne aufwendige Gerüststellung oder Hubleiterwagen präzise erfasst und dokumentiert werden. Das digitale Monitoring-Verfahren bietet somit ein hochpräzises und kosteneffizientes Instrument zur Überwachung von Kalksandstein-Objekten und unterstützt Expert:innen dabei, geeignete Erhaltungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen.
Bei Fragen zum Digitalen Monitoring:
Christoffer Diedrich
Sachbereichsleiter Dokumentation
Tel: 0251 591-4038