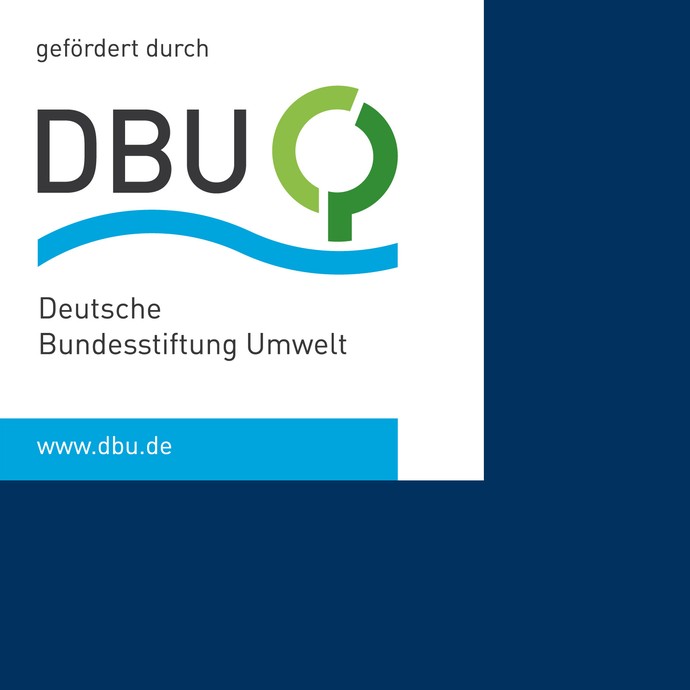Probenentnahmen für Analysen
1 | MODUL : ERKENNEN
Alle hier bisher aufgeführten Untersuchungsmethoden beziehen sich auf in situ-Untersuchungen am Objekt. Mitunter ist es notwendig, für begleitende naturwissenschaftliche Untersuchungen, gezielte Proben vom Objekt für die anschließende Untersuchung im Labor zu entnehmen. Dabei ist von entscheidender Wichtigkeit, dass die Probe für die klar formulierte Fragestellung repräsentativ und gleichzeitig möglichst klein – mikroskopisch – ist.
Mikroskopische Gefügeanalyse
Bei der mikroskopischen Gefügeanalyse werden Proben von Gesteinsbruchstücken unter dem Mikroskop oder Dünnschliff-Präparate unter dem Polarisationsmikroskop untersucht.
Die Polarisationsmikroskopie arbeitet mit speziell gefiltertem Licht und gilt als Standardverfahren zur Identifizierung von Kristallstrukturen in Mineralen und zur Texturanalyse. Neben der Bestimmung der mineralogischen Zusammensetzung können auch mögliche Salze eines Gesteins nachgewiesen werden. Die Untersuchung von Struktur, Textur und Phasenbestand gibt außerdem wichtige Hinweise auf die Bildungsprozesse des Gesteins. Darüber hinaus lassen sich wertvolle Erkenntnisse über die Gesteinskörnung, deren Verteilung sowie über Porenfüllungen und mögliche Risse gewinnen. Insbesondere Verlauf, Häufigkeit und Hauptorientierung von Rissen können analysiert werden. Insgesamt gibt die mikroskopische Gefügeanalyse präzise Hinweise auf Schadensmerkmale im mikroskopischen Bereich des Gesteins.
Salzanalyse
Um die Salzbelastung eines Gesteins zu bestimmen, werden von Salzen, die auf oder nahe an der Oberfläche liegen, Abkehrproben genommen oder an entnommenen Gesteinsbruchstückchen analysiert. Um eine Salzbelastung im Tiefenprofil des Werksteins untersuchen zu können, werden Bohrmehlproben aus festgelegten Tiefenabschnitten (Segmenten) mithilfe eines Spiralbohrers entnommen.
Das Probenmaterial wird im Labor aufbereitet und anschließend detailliert untersucht. Die Anionenkonzentrationen, darunter Chlorid, Nitrat, Sulfat, werden mithilfe der Ionenchromatographie (IC) bestimmt. Kationenkonzentrationen, wie Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium werden mittels optischer Emissionsspektrometrie ermittelt. Falls notwendig, werden Natrium und Kalium noch weitergehend mit der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) bestimmt.
Die gewonnenen Messwerte geben Rückschlüsse auf die qualitative und quantitative Konzentration bauschädlicher Salze. Dazu gehören insbesondere Nitrate, Sulfate, Chloride und Carbonate. Diese Salze können durch Hydratationsprozesse (Anlagerung von Wassermolekülen) oder Kristallisation zu Volumenveränderungen führen, was Druck auf das Gesteinsgefüge ausübt. Dies kann Abplatzungen oder Spaltungen begünstigen und langfristig zur Schädigung des Gesteins führen.
Eine umfassende Salzanalyse macht es möglich, potenzielle Schäden und deren Ursachen frühzeitig zu beurteilen.
Mikrobiologische Analysen
Zeigt sich der Bedarf der genaueren Klärung von mikrobiologischer Besiedlung im Zusammenhang mit Schädigungen des Gesteins, kann eine Laboranalyse weitere Informationen zu Spezies und Maßnahmen zu deren Reduktion liefern.
Hierzu wird eine Material- oder Abklatsch Probe der entsprechenden mikrobiologischen Besiedlung genommen, steril verpackt, und im Fachlabor auf Nährböden kultiviert. Anschließend werden die Proben makro- und mikroskopisch untersucht.
Die Ergebnisse der Analysen können häufig Rückschlüsse auf die biogenen Ursachen der Gesteinsschädigung zulassen. Ein besseres Verständnis der mikrobiologischen Interaktionen mit dem Gestein erleichtert die Entwicklung gezielter Maßnahmen zur Reduktion oder Verhinderung weiterer Schäden.
Analyseergebnisse können einen Hinweis auf mögliche Schäden geben: